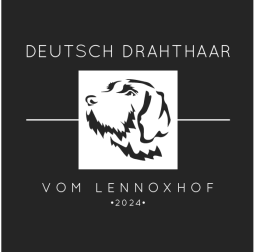Deutsch Drahthaar vom Lennoxhof
Die drei wichtigsten Stadien der Geburt / Geburtssttadien

Grundsätzlich haben Fremde während der Geburt im Wurfzimmer nichts verloren, auch keine Fremden vor der Tür sowie das andere Rudel auch nicht vor der Tür des Wurfzimmers verweilen sollte.
Dies würde selbst die souveränste und wesensstabilste Hündin im Unterbewusstsein stressen.
Und diesen Stress sollte man der Hündin nehmen.
Im allgemeinem beschreibt man die Geburt der Hündin in drei Stadien, tatsächlich gibt es aber auch noch ein vorbereitendes Stadium. Da habe ich im Ansatz schon drüber geschrieben unter: Zucht/Anzeichen der einsetzenden Geburt. In dieser Phase fällt der Progesteronspiegel im Blut, der für die Aufrechterhaltung der Gravidität und der beim Wachstum der Föten das Zusammenziehen des Uterus verhindert, ab.
Nun übernehmen die Östrogene wieder ihre Aufgaben. Die Produktion von Prostaglandin wird stimuliert wodurch die Geburt beginnen kann. Wir hatten auch schon über die abfallende Körpertemperatur auf Grund der von den Welpen ausgeschütteten Cortisolspiegel und die damit verbundene abfallende Körpertemperatur gesprochen.
Für uns Züchter ist es aber kein wirklich sicheres Zeichen das die Geburt in den nächsten 12-24. Stunden beginnt. Wichtig ist für uns zu wissen, dass die Körpertemperatur der Hündin in den letzten Wochen vor der Geburt tendenziell etwas niedriger ist als normal.
Stadium eins:
Es sind die Föten, nicht die Hündin, die die Geburt auslösen. In den letzten Tagen vor der eigentlichen einsetzenden Geburt werden die Föten im Uterus zusammengepresst, sie unterliegen da vermehrtem Stress ( dieser Geburtsvorbereitungs- und Geburtsstress ist für die Entwicklung unserer zukünftigen Jagdhelfer sehr wichtig).
Dieser Stress stimuliert das noch nicht komplett ausgereiften Herz und Kreislaufsystem, sich auf die notwendigen Veränderungen von intrauterin nach extrauterin vorzubereiten.
Im Verlaufe dieses Stadiums wird die Hündin sehr unruhig (Erstgebärende meist noch mehr als schon erfahrene Zuchthündinnen), die Hündin verweigert meist 18 bis 24 Stunden vorher das Futter (aber auch in diesem Stadium eins sind nicht alle Hündinnen gleich), mache erbrechen sich. Es folgt dann ein sehr intensives Hecheln, das auch bis zu 24 Stunden dauern kann, bei manchen auch nur 1-2 Stunden anhält. Das heißt aber nicht das die Hündin die ganze Zeit über diese Anzeichen zeigt, es ist nicht ungewöhnlich das die Hündin zwischendurch auch wieder zur Ruhe kommt und etwas schläft. Die Hündinnen kratzen sehr viel, sind ruhelos. Wie schon beschrieben kann dieses Stadium eins von 2-48 Stunden anhalten, meist aber nur 6-12 Stunden.
Hündinnen sind zu einer unendlichen Vielfalt von Verhaltensmustern in der Lage.
Das Zerreißen der Wurfkisteneinlagen (dafür nehmen wir alte gewaschene Bettlaken) wird heute nicht mehr nur als primitiver Impuls gesehen, den Welpen ein Nest vorzubereiten. Richtig interpretiert wird es als Reaktion auf Schmerzen, ausgelöst von dem vollen Uterus, der nach unten auf den Muttermund drückt, und damit seine Öffnung vorbereitet. Auch können kurze Episoden des Zerreißens auch zwischen den einzelnen Geburten beobachtet werden, sogar noch Tage danach, wenn die Nachwehen kommen. Während der Trächtigkeit beobachtet man meist einen leichten, schleimigen Ausfluss aus der Vulva. Kurz vor der Geburt steigert sich die Schleimmenge, eine Art Schleimpfropfen, der den Muttermund geschlossen hatte, löst sich aus der Vulva oft in Form von schleimigen Fäden. Also das Stadium eins beinhaltet in der Regel die Zeichen die wir in dem Themenbereich „wie erkenne ich das die Geburt beginnt“ beschrieben haben.
Hinzuzuführen ist nur, das im Stadium eins sich die Cervixuterie (der Gebärmuttermund) sich soweit eröffnet hat, dass dadurch die Welpen geboren werden können was das Stadium 2 jetzt beschreibt.
Solange der Gebärmuttermund nicht vollständig offen ist, ist eine natürliche Geburt eines Welpen nicht möglich. Das Öffnen des Muttermundes wird durch die Wehen veranlasst, also durch die Kontraktion des Uterus, die wiederum durch das Hormon Oxytocin ausgelöst werden. Das Hormon Oxytocin wird bei einer gesunden Hündin in der Hirnanhangdrüse in ausreichender Menge produziert.
Leider ist es bei unseren Deutsch Drahthaar nicht möglich mit den Fingern zu ertasten (wie in der Humanmedizin) ob der Muttermund vollständig geöffnet ist.
Stadium zwei: der Weg
Im Idealfall verändern die Föten ihre Stellung im Uterus so , dass sie mit dem Kopf zuerst den Geburtskanal passieren, so durch den offenen Muttermund gelangen und geboren werden können. Diese Geburtslage nennt man Kopfgeburt (VEL= Vorderendlage).
Oft liegen sie in der Gebärmutter auf dem Rücken. Unverändert sollte der Fötus sich in der doppelwandigen Fruchtblase befinden, die ihn auf die Reise gegen Stoßen, Quetschen und Spannungen der Gebärmuskulatur schützt, die noch durch die Bewegungen der Vagina verstärkt werden.
Selbst wenn der Muttermund der Hündin vollständig geöffnet ist, gibt es für einen durchschnittlich großen Welpen wenig Raum hindurchzukommen.
Jüngere Forschungen ergeben, dass die Föten alternativ aus den beiden Gebärmutterhörnern abgegeben werden.
Es kann zu konkreten Schwierigkeiten kommen, wenn der Fötus den Muttermund in falscher Lage erreicht z.B. mit abgeknicktem Kopf, so dass die Schulter als erstes ihren Weg sucht. Möglich ist auch, dass der Fötus am Muttermund vorbeigleitet und beginnt sich wieder nach oben in das gegenüberliegende Gebärmutterhorn zu bewegen.
Hält ein Fötus auf diese Art die Geburt auf oder liegt ein deutlich übergroßer oder toter Welpe am Muttermund quer, kann dies die Geburt der folgenden Welpen gefährden. Hat sich die Plazenta erst einmal von der Gebärmutterwand getrennt, ist es wichtig, dass der Fötus so schnell wie möglich geboren wird. Ebenso überlebensnotwendig ist es, dass Welpen, wenn sie erst einmal auf der Welt sind, so schnell wie möglich ihren ersten Atemzug tun.
Dies ist in der Regel bei unseren instinktsicheren Hündinnen kein Problem diesen Job mit Bravour zu meistern.
Die ersten Anzeichen:
Die Hündin hat mit dem Hecheln aufgehört, sie ist etwas ruhiger geworden, jetzt ist es an der Zeit, wo man starke Wehen-Bewegungen der Hündin erkennt, wenn sie nach hinten beginnt zu pressen.
Die Wehen-Bewegungen des Unterleibes sind noch eindrucksvoller zu erkennen.
Das erste Anzeichen der direkt kurz bevorstehenden Geburt des 1. Welpen ist das Austreten einer mit schwarzer Flüssigkeit gefüllten Blase an der Schnalle. Dies ist die Fruchtblase, die äußere Membran, welche jeden Fötus während der Tragzeit umgibt und jetzt dazu dient, die Passage in die Welt hinaus gleitfähig zu machen.
Diese Fruchtblase tritt hervor kann sich aber auch mehrfach wieder etwas zurückziehen, es ist aber auch möglich, dass diese in der Hündin schon perforiert (geplatzt) ist, dann tritt ein Flüssigkeitsschwall aus der Hündin heraus. Diese gefärbte klare Flüssigkeit ist das sicherste Indiz für den Beginn der Austreibungsphase.
Es ist nicht besorgniserregend wenn diese Fruchtblase keinen Welpen mitbringt.
Der Welpe sollte dann aber kurz darauf geboren werden, da er jetzt ungeschützt im Geburtskanal sitzt. Das ist für eine befristete Zeitdauer ohne Gefahr, denn unverändert ist er noch über die Nabelschnur mit der Plazenta und somit mit dem mütterlichen Kreislauf verbunden. Mit zunehmender Dauer kann aber auch dies zu Komplikationen führen, wenn sich beispielsweise die Nabelschnur um den Kopf des Welpen wickelt.
Dazu später mehr bei Geburtskomplikationen.
Wenn erst mal der Kopf des Welpen aus der Schnalle austritt, folgt der Rest vom Welpen schnell hinterher.
Tritt aber bei Presswehen eine Pause auf, nachdem der Welpe schon in der Schnalle sichtbar ist, kann man der Hündin helfen, indem man bei der nächsten Presswehe mit einem sterilen Tuch und sterilen Handschuhen sehr sanft während die Hündin presst, den Welpen gut umfasst und nach unten zieht.
Tipp: Leichtes einfetten mit Vaseline oder sterilem Gleitgel macht das Ende des Geburtsweges gleitfähiger.
Dies braucht man, wenn überhaupt auch nur beim ersten Welpen zu machen.
Der erste Welpe erweitert/ebneten den Geburtskanal meist für alle Geschwister.
Wenn der erste Welpe mit den Hinterläufen zuerst kommt (HEL = Hinterendlage) wird es etwas schwieriger, weil nicht das breiteste Körperteil des Welpen den Weg öffnet.
Es werden etwa die Hälfte aller Welpen mit den Hinterläufen (HEL) zuerst geboren, wenn es sich dabei nicht um das Erstgeborene handelt, macht diese Geburtslage keine Schwierigkeiten.
Wichtig ist hier zu wissen das, wenn es sich in der Geburtshilfe beim Hund um eine Geburt mit den Hinterläufen zuerst handelt, ist es keine Steißgeburt ist. Die Bezeichnung Steißgeburt begrenzt sich auf Welpen, bei denen zuerst der Rumpf kommt, während die Hinterläufe unter dem Körper gelagert sind.
Tipp : Wenn der Kopf abgeknickt ist oder ein Lauf sich hinter dem Welpen verfangen hat, kann man möglicherweise mit Hilfe von sterilem Gleitgel und deinem Zeigefinger helfen, den kleinen Körper ein eine gerade Linie zu bringen. Oft wird schon eine kleine Drehung des Welpen enorm hilfreich sein. Vorsicht aber walten lassen, nie stärker am Kopf oder einzelnen Gliedmaßen ziehen.
Empathisch einfühlend mit sanften druck gleichmäßig vorsichtig ziehen und dass nur wenn die Wehe einsetzt.
In diesem Stadium den Tierarzt zu rufen wäre eh zu spät, da wäre der Welpe tot bevor der Tierarzt kommt.
Ruhe bewahren und selbst versuchen heißt es in solch einer Phase.
Tipp:
Man kann die Hündin stimulieren, eine extra kräftige Wehe auszulösen, indem man mit den Fingern gegen die Innenseite der Scheide drückt. Man nennt dies feathering, gerade in Amerika wird diese Methode der Stimulanz gebärender Hündinnen stark eingesetzt. Es wird behauptet das diese Methode unter der Geburt genau so wirksam ist die Gabe von Oxytocin.
Erstgebärende Hündinnen zeigen sich oft überrascht bei der Geburt ihres ersten Welpen. Befindet sich der Welpe noch in der Fruchtblase, so wird diese schnell von der instinktsicheren Hündin mit ihren Zähnen geöffnet, sie frisst die Membran auf. Oft kommt auch die Plazenta (Mutterkuchen/Nachgeburt) gleichzeitig mit dem Welpen zum Vorschein, mit ihr ist der Welpe über die Nabelschnur verbunden. Dann trennt die Hündin die Nabelschnur vom Welpen ab, das geschieht zumeist mit den Prämolaren, nicht wie so viele meinen mit den Schneidezähnen.
Ist die Plazenta wie beschrieben mitgekommen, dann wird diese samt Nabelschnur von der Hündin aufgefressen. Das ist wichtig und man sollte die Hündin keinesfalls daran hindern. Die Plazenta ist für unsere Hündin eine besondere hormonelle Nahrung. Sie braucht alle die im Mutterkuchen vorhandenen Vitamine, Hormone und Nährstoffe für ihre Welpen, der Verzehr der Plazentas ist Wehen- und Laktationsfördernd (Milchfördernd).
Es gibt Züchter die ihrer Hündin nicht oder nur wenige Plazentas fressen lassen und die anderen ihr entziehen mit dem Argument die Hündin bekäme davon Durchfall.
Wie oben beschrieben ist es sehr wichtig für die Hündin und Welpen das die Nachgeburt von der Hündin gefressen wird. Auch wenn sie auch mal 1-2 Tage nach der Geburt weichen Output hat ist das nur förderlich.
Die Hündin beginnt nun damit den Welpen mit ihrer Zuge zu massieren, oft erscheint dies sehr grob, wenn die Hündin die Welpen durch die Wurfkiste hin und her drehen, an der Nabelschnur zieht. Diese grob wirkende Rollen, Lecken und ggf. noch mal an der Nabelschnur reißen ist der natürliche Weg, die Atmung der Welpen durch die Hündin zu stimulieren. Manchmal tragen sie die Welpen auch durch den Wurfraum, dies ist alles nicht ungewöhnlich.
Wenn der Welpe dann aber das erste Mal schreit, wird bei einer instinktsicheren Hündin jetzt mütterliches Verhalten festgestellt.
Es kann aber auch sein das gerade die Erstlingshündin durch diese Geburtsgeschehnisse recht hilflos ist, ihr Neugeborenes betrachtet und nicht weiß was sie damit machen soll.
Tipp:
machen sie nicht den Fehler und übernehmen direkt von Anfang an die Aufgaben ihrer Hündin. Greifen sie hier nur ruhig ein indem sie der Hündin den Welpen vorhalten, versuchen sie ihre Hündin zu animieren selbst zu lecken und die Blase zu öffnen. Zu 90 % leckt die Hündin ihre Hände und den Welpen, in aller Regel erwacht jetzt der später auch so wichtige Instinkt ihrer Hündin, sie packt den Welpen aus der Eihaut aus, nabelt selbst ab und beginnt mit der Pflege.
Dies sollte man immer als erstes versuchen.
Ist die Hündin aber so benebelt, dass wir von einem Ausfall der Instinkte ausgehen müssen, dann muss der Züchter agieren.
Viel Zeit darf jetzt nicht mehr verstreichen!
Der Welpe ist jetzt nicht mehr über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden und die Sauerstoffversorgung ist nicht mehr gegeben. Zudem besteht die Gefahr das der Welpe Fruchtwasser aspirieren (einatmet) könnte was dann zum Atemstillstand führt. Deshalb muss jetzt, wenn die Hündin nicht zu bewegen ist ihre Instinkte walten zu lassen der Züchter handeln.
Tipp:
Die Fruchtblase wird unter der Kehle so geöffnet, dass wir den Welpen mit dem Kopf nach unten in der Hand halten, so dass das Fruchtwasser direkt abfließen kann, ohne dass der Welpe sich an dem Fruchtwasser verschlucken kann und das Fruchtwasser so auch nicht in die Atemorgane gelangt.
Die Fruchthäute werden Handschuhartig von unten nach oben abgestreift, gleichzeitig pressen wir zwischen Daumen und Zeigefinger die Nabelschnur zusammen.
Erneut versuchen wir unsere Hündin zu überreden, jetzt ihre Arbeit zu beginnen, die Nabelschnur abzukauen, denn sie kann dies am besten mit ihren Prämolaren.
Hilft dies nichts, trennen wir die Nabelschnur etwa 2 cm vom Ansatz also von der Bauchdecke entfernt durch Abquetschen zwischen den Fingernägeln ab.
Ich praktiziere das immer so durch Abquetschen mittels unserer Fingernägel, keinesfalls durchschneide ich die Nabelschnur. Die Nabelschnur enthält Blutgefäße für arterielles wie auch venöses Blut. Nur dadurch war der Anschluss an den mütterlichen Blutkreislauf möglich. Würde ich die Nabelschnur mit der Schere abschneiden, ohne vorher abzuklemmen oder mit Zwirnschlinge abzubinden wäre ein starker Blutverlust des Welpen unvermeidbar. Das Abquetschen der Nabelschnur mit den Fingernägeln entspricht weitgehend dem Quetschen und Abdrücken durch die Backenzähne der Hündin.
Wenn man sich das so nicht zutraut kann man dies auch mit einer Nabelklemme oder mit Zwirnschlinge abbinden und dann mit einer Schere hinter dem Zwirn durchtrennen. Der Nabelschnurrest am Welpen trocknet bald aus und fällt von allein ab.
Gibt der Welpe bis dahin immer noch kein Lebenszeichen von sich dann rubbeln wir ihn mit einem kleinen Frotteehandtuch oder Mikrofasertuch trocken, diese Massage führt meist zum ersehnten ersten Schrei.
Scheint der Welpe noch immer leblos, sollte man seinen Körper mit dem Kopf zwischen Daumen und Zeigefinger oder zwischen Zeige- und Mittelfinger fest in die Hand nehmen, so den Kopf gut stabilisieren und halten und dann in dieser Haltung neben sich ziemlich heftig nach unten schwingen.
Dadurch werden die Atemwege des Welpen befreit, dieser Vorgang können wir 2-3-mal wiederholen.
Ist dann immer noch kein Leben in dem Welpen, versuchen wir das eventuell doch aspirierte Fruchtwasser los zu werden indem wir den Welpen bzw. den ganzen Fang des Welpen an unseren eigen Mund nehmen und das Fruchtwasser mit unserm Mund raus saugen (dieses dann ausspucken). Dann beginnen wir leicht unseren Atem den Welpen einzublasen.
Hierbei ist Vorsicht angezeigt, denn zu starkes Beatmen könnte wiederum den Welpen schaden.
Eine weiter Möglichkeit, die mein Großvater praktiziert hatte, war den guten hochprozentigen Polnischen Vodka den Welpen mit den Fingern in sein Mäulchen zu träufeln, wenn man das mit Vodka nicht machen möchte hilft auch Doxerpram vom Tierarzt.
Wobei ich mit dem Vodka schon einmal einen vermeintlich toten Welpen sofort zum Atmen stimuliert bekommen habe. Es funktionierte perfekt. Die vet. Mediziner werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber Doxerpram hatte bei diesem Welpen nicht die gewünschte Wirkung gezeigt und Vodka schon.
Ein altes Sprichwort aus meiner 25-jährigen Intensivmedizin besagte „Wer heilt hat recht“. Wenn nicht zu funktionieren scheint ist es auf jeden Fall einen Versuch wert. Der Wettlauf um den ersten Schrei ist manchmal aufregend. Wichtig ist Ruhe zu bewahren und Nerven behalten. Gehen sie davon aus das ein neugeborener Welpe gar nicht so zart und empfindlich ist, wie es scheint.
Er kann bei diesem Prozedere ruhig sicher und feste angefasst werden.
Wenn sie sehen wie ihre instinktsichere Hündin die Welpen anpackt dann wissen sie, dass die neugeborenen Welpen einiges vertragen können. Hat dann nun endlich der ersehnte Schrei funktioniert ist es wichtig, dass der Welpe, dem sehr geholfen werden musste, unbedingt gekennzeichnet werden sollte. Etwas roten Nagellack auf den Hinterlauf oder am Rutenansatz aufs Fell ist immer gut zu erkennen.
Das ganze Prozedere sollte man, wenn dazu zwischendurch Zeit ist, auch dokumentieren.
Hier kurz noch mal die Geburtsstellungen:
Physiologisch ist die Kopfgeburt (VEL) und Hinterläufe voran (HEL) wie schon beschrieben bei der Normalgeburt.
Nicht korrekte Geburtsstellungen:
1. Abknicken des Kopfes
2. Seitwärtsstellung des Kopfes
3. Steißgeburt
4. Querlage
Wenn alles gut gegangen ist, ist es wichtig das der Welpe zur Zitze findet und die erste so wichtige Colostralmilch zu sich nimmt und wir sehen das der Saugreflex sehr gut ausgeprägt vorhanden ist. Wieder setzt eine Instinkthandlung ein. Der Welpe findet selbstständig zur Wärme- und Milchquelle, öffnet sein Mäulchen, seine Zunge umfasst trichterförmig die Zitze, der Sauge- und der Milchtritt setzt ein.
Es ist jedes Mal ein Wunder so eine Geburt.
Stadium 3:
Es ist Aufgabe des Züchters die Wurfkiste auch zwischen den einzelnen Intervallen der Geburten trocken zu halten und die Unterlagen auszuwechseln. Jeder neue Welpe bringt viel Nässe in das Welpenlager.
Trotzdem ist es immer besser, bereits geborene Welpen auf jeden Fall bei der Hündin zu lassen.
Wenn sie an den Zitzen saugen stimuliert dieses Saugen auch wieder die Wehen. Manche Züchter empfehlen, während der Geburt des nächsten Welpen die vorhandenen Welpen in einen gesonderten Korb zu legen.
Ich finde das es sich im allgemeinem nicht bewährt, denn es kann die Hündin stören und zu Stress führen, wenn wir ihr die Welpen aus ihrer Wurfkiste nehmen.
Ich benutze Polyestertücher und Moltonauflagen, die ich unter das Gesäß der Hündin legen und mit jedem neuen Welpen wechseln. Ich fange mit Zellstoff so viel Flüssigkeit wie es geht auf. Die Welpen, die schon geboren sind, liegen dann in der Wurfkiste am geschützten Rand während der nächste Welpe geboren wird.
Meine Wurfkiste ist zur Hälfte auch eine Höhle. Ich habe diese so konstituiert, dass ich die Wurfkiste oben in drei Teilen schließen kann (drei abnehmbare Deckel). Ich habe die Erfahrung gemacht das die Hündinnen lieber in einer zumindest teilweisen höhlenartigen Wurfkiste entbinden.
Ich schließen die Wurfkiste während der laufenden Geburt nicht ganz zu, damit ich die Hündinnen gut beobachten und ich im Notfall agieren kann.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass mit oder nach dem Welpen die Nachgeburten ausgestoßen wird.
Hier muss ganz einfach gezählt werden. Dabei kann es passieren, dass beispielsweise eine Nachgeburt in einem Gebährmutterhorn hängen bleibt. Bleibt eine Plazenta unbemerkt im Uterus hängen, dann kann diese sehr leicht zu einer lebensbedrohlichen Infektion der Hündin führen, ebenso wenn ein toter Welpe unbemerkt in der Hündin bleibt.
Spätestens 24 Stunden nach der Geburt beginnt die Plazenta und oder der tote Welpe in der Hündin zu verwesen. Eine schlimme Sepsis ist die Folge und eine sehr große Gefahr die Hündin und die übrigen Welpen darstellt.
Aus diesem Grund ist es bei mir Standard nach der für mich vermeintlich abgeschlossene Geburt die Hündin Röntgen zu lassen, um sicher zu gehen, dass sie wirklich komplett leer ist.
Ein sehr erfahrener Züchterkollege war der festen Überzeugung die Kunst beherrschen zu können nach über 20 Jahren Zuchterfahrung durch Abtasten und Befühlen der Hündin zu erkennen, ob die Hündin komplett leer ist oder ob noch ein Welpe innehat.
Er fand dieses Röntgen nach der Geburt modernen Nonsens und unnötiges Geld verschwenden. Nachdem er dann eine seiner sehr guten Zuchthündin eine Woche nach der Geburt fast genau aus dem Grund das die Hündin noch einen toten Welpen inne hatte fast verloren hätte sie am 10 Tag dann total operiert werden musste und komplett leer geräumt werden musste , es ihr tagelang so schlecht ging mit der Sepsis das er die 10 Welpen mit der Flasche groß ziehen musste , diese auch erkrankt waren wegen der hohen Temperaturen und der Sepsis der Hündin hat er seine Aussage revidiert und lässt jetzt jede Hündin nach vermeintlich abgeschlossener Geburt Röntgen.
Ein trauriges und teures Lehrgeld musste er bezahlt.
Medizinisch gesehen ist es nicht möglich allein durch Ertasten sicher zu sein und erkennen zu können das die Hündin leer ist. Genauso so unmöglich ist es ertasten zu wollen wie viele Welpen die Hündin inne hat.
Meine Hündinnen bekommen 2-3 Tage Post Geburt Oxytocin gespritzt, das auch die letzte Plazenta und der letzte Schmodder ausgeschieden wird (es ist nicht ungewöhnlich das die Hündin 24 Stunden nach der Geburt beim nässen noch mal eine Plazenta ausscheidet) und sich der Uterus dadurch auch wieder schön zurück entwickelt.
Positiv ist dies auch für die Mich Produktion der Hündin, da Oxytocin auch Laktationsfördernd ist.
Außerdem bekommt die Hündin bei groß Würfen über 8 Welpen drei Tage lang ein Antibiotikum (Amoxicillin) rein prophylaktisch.
Nun noch mal zu den Nachgeburten, wie schon beschrieben bin ich ein große Freund davon das meine Hündinnen all die Nachgeburten auch fressen sollen.
Wenn eine Hündin mit Kaiserschnitt entbunden hat, hat die Hündin in der Regel keine Chance, die Plazenta (Nachgeburten) aufzufressen. Dafür besteht aber kein vernünftiger Grund.
Wenn man rechtzeitig daran denkt den Tierarzt zu bitten, die Nachgeburten aufzubewahren, sie mit der Hündin und den Welpen zurückbekommt, so dass die Hündin, wenn sie nach der Narkose wieder richtig fit ist und fressen darf diese verzehren darf.
Es sei hier aber auch noch mal darauf hingewiesen, dass Hündinnen, die mit Kaiserschnitt auf Grund von einer primären Wehenschwäche entbunden haben laut der Vererbungs- und Verhaltensforscher aus der Zucht zu nehmen sind und auch die Nachzucht der Kaiserschnitt Hunde nicht in die Zucht gehören.
Die schon beschriebene Wehenschwäche ist die Hauptindikation für einen Kaiserschnitt. Wehenschwäche tritt vor allem als erblich bedingte Fehlleistung als ausgefallene hormonelle Steuerung auf. Die Bekämpfung dieses Übels ist durch gezielte züchterische Selektion zu beheben.
Bei Deutsch Drahthaar eine sehr selten vorkommende erbliche Erkrankung die nur in manchen Linien vorkommt. Andre Rassen sind da viel häufiger von betroffen.
Aus dem Grund werden bei vielen Zuchtvereinen Hündinnen bereits nach dem 1. Kaiserschnitt mit einer Zuchtsperre belegt.
Beim VDD und bei allem anderen dem VDH angehörenden Rassen werden die Hündinnen nach dem 2. Kaiserschnitt mit einer Zuchtsperre versehen.
Natürlich ist auch bei dem Erbfehler Wehenschwäche an die Selbstreflektion der Züchter zu appellieren keinen Hund in die Zucht zu nehmen der diesen Erbfehler tragen könnte.
Nicht nur Hündinnen sondern natürlich auch Rüden vererben die Wehenschwäche.
Erfahrene Wissenschaftler betonen stets, welche grundsätzliche schwere eigen Verantwortung für die Gesunderhaltung der jeweiligen Rasse auf den Schultern der Züchter liegt!
Wir sind sehr froh bei Deutsch Drahthaar so eine breite, gesunde Zuchtbasis zu haben mit so vielen selbstkritischen und verantwortungsvollen Züchter die unsere Zucht weiter auf so hohem Niveau halten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.